Bionische Analogien zur Gestaltung lebender Organisationen
Den Aufruf moderne Organisationen wie lebende Organismen zu gestalten vernimmt man immer häufiger. Mit einem solchen Bild vor Augen werden häufig agile, selbstorganisierte Organisationen assoziiert, die sich durch eine dezentralere Entscheidungsfindung und den Abbau Hierarchien auszeichnen. Eine Organisation, die gefühlt flüssiger, weniger starr – eben organischer anmutet. Und damit stehen sie ganz im Gegensatz zu den tayloristischen Unternehmensgefügen des 20. Jahrhunderts. Ich frage mich daher, was denn genau das „Organische“ an diesen Ansätzen ist, als Gegenpol zum – „Anorganischen“, das offenbar ausgediente Organisationsformen anhaftet. Wie genau können diese neuen lebenden Organisationsform aussehen?
Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, beginnt die Suche ganz nahe liegend in der Biologie – der wissenschaftlichen Heimat alles Lebenden. Bevor man jedoch beginnt sich lebende Vorbilder für unsere Organisation zu suchen, stellt sich eine viel grundlegendere Frage: Ist es überhaupt zulässig Analogien aus biologischen Vorbildern zu ziehen? Können wir überhaupt biologische Systeme auf soziale Systeme übertragen?
Der bionische Blick in die Blaupausen des Lebens
Sobald wir von der Natur lernen möchten, betreten wir das Spielfeld einer der bekanntesten Analogiemethoden – der Bionik. Der Reiz sich an den Errungenschaften der Schöpfung zu orientieren liegt auf der Hand: Die Ergebnisse der Evolution, ob wir nun über Lebewesen oder ganze Ökosysteme sprechen, haben allesamt einen unvergleichlichen Optimierungsprozess durchlaufen. Jedes Lebewesen wurde durch unzählige „Trail and Error“-Versuche zu nahezu vollkommener Perfektion gebracht. Möchten wir uns zur Gestaltung unserer Organisation in diesem beispiellosen Fundus bedienen, können wir dies auf dreierlei Weise tun:
- Zu aller erst können wir uns konkrete Ergebnisse der Evolution zum Vorbild nehmen. Dieser bionische Blick hat uns bereits Reißverschlüsse, Tragflächen oder auch mit Lotus-Effekt beschichtete Dachziegel beschert.
- Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass wir uns am Prozess der Evolution selbst bedienen. Hierbei geht es darum die Optimierungsverfahren selbst, die zu den Ergebnissen der Schöpfung geführt haben für unsere Zwecke nutzbar zu machen. Nutzbare Anwendungen dieser bionischen Form des Lernens finden wir heute in Form von Algorithmen, die biologische Wachstumsregeln oder Populationen und deren Selektion simulieren.
- Der dritte Weg ist die Übertragung von grundlegenden Prinzipien der belebten Natur. Dies sind beispielsweise das Übertragen von Selbstorganisation, Adaptivität oder Modularität, die in vielerlei Form in der Natur beobachtet werden können [2][4].
Um zu operationalisierbaren Ansätzen zur Gestaltung von Organisationen zu gelangen, bietet sich aus meiner Sicht insbesondere der dritte Weg an: Das Übertragen natürlicher Erfolgsprinzipien. Die bisherigen systemtheoretischen Ansätze der Kybernetik, wie das Viable System Model (VSM) von Stafford Beer, autopoetische Systeme nach Maturana und Varela bis hin zur Luhmannschen Theorie sozialer Systeme orientiert sich auf diese Weise an der Natur. Das VSM stellt hierbei womöglich einen Hybriden zwischen den bionischen Ansätzen dar, da es sich zudem am gegenständlichen Aufbau eines Nervensystems orientiert und damit auch den ersten Weg der Analogienfindung beschreitet [1]. Auch sind viele agile Organisationsansätze der letzten Jahre wie „Fail-fast“, oder das Verändern in „Experimenten“ anstelle geplanter Vorhaben, ein Abbild des evolutionären Prozesses.
Eine grundlegende Herausforderung bei der bionischen Übertragung auf andere Bereiche ist die Überlegung, inwiefern die gefundene Analogie zulässig ist? Von einem biologischen System kommend stellt sich die Frage, ob soziale Systeme ausreichend ähnlich sind, um vom einen auf das andere zu schließen? Dieser Frage kommt insbesondere eine große Bedeutung zu, wenn man sich, so wie meine Kollegen mit einem unüblichen Beobachtungsobjekt beschäftigt. Zur Definition unseres bionischen Organisation-Systems übertragen wir den kleinsten gemeinsamen Nenner alles Lebenden: Die Zelle.
Warum das eine so bestechende Wahl ist, habe ich in einem meiner früheren Artikel erläutert.
Durch unsere Wahl die Zelle als Baustein lebender Systeme zu übertragen, befinden wir uns in der Sphäre der Molekularbiologie. Doch gerade die Wissenschaft der Molekularbiologie operiert in einem spannenden Grenzbereich der Biologie: Sie ist das Bindeglied zwischen der Welt des Unbelebten (Anorganischen) und der Welt des Lebenden (Organischen). Denn obwohl die Molekularbiologie auf den mechanistischen Grundgesetzen der Physik und Chemie basiert, ist das was sie letztendlich hervorbringt das Phänomen des Lebens. Und dieses Leben – das nehme ich gleich vorneweg – ist alles andere als deterministisch, wie Physik und Chemie es sind.
Vom Unbelebtem zum Lebenden
Doch wie kann das sein, dass ein molekularbiologisches System, das auf den kausalen Regeln der Physik basiert, nicht selbst nach rein kausalen Zusammenhängen funktioniert?
Denn mit physikalischen und chemischen Naturgesetzen ist das so eine Sache: Was auch immer passiert es ist vorherbestimmt. Physikalische und chemische Gesetze beschreiben klipp und klar das Zusammenspiel von Materie und Energie: Werfe ich einen Stein, kann ich dessen Flugbahn, Aufprallkraft und beliebige andere Größen berechnen. Alle Zusammenhänge sind vorhersagbar und werden immer genauer je mehr physikalische Größen ich dabei berücksichtige, beginnend mit der Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit bis hin zum Strömungskoeffizienten des Steines. Das Gesamtsystem „geworfener Stein“ ist nämlich nur kompliziert, und es kann vollständig durch die Beschreibung seiner Einzelteile in seiner Gesamtheit erfasst werden.
Diese kausalen Zusammenhänge gelten auch für die zugrunde liegende Chemie der Zelle: Moleküle in einer Zelle besitzen eine physische Form, bewegen sich mit einer Geschwindigkeit und sind somit klar an die festen Gesetze von Zeit und Raum gebunden. Ihr physisches Fortkommen wird durch die Regeln der Diffusion beschreiben. Vergleichbar stringent verhält es sich mit den chemischen Reaktionen innerhalb der Zelle: Es ist klar festgelegt welche Moleküle, wie genau miteinander reagieren können und wie viel freie Energie hierfür nötig ist oder durch ihre Reaktion frei wird. In den physischen und chemischen Vorgängen gibt keinen Freiheitsgrad darüber wie das Ergebnis aussieht.
Angesichts dieser Tatsachen könnte man tatsächlich auf die Idee kommen, das alles Leben vorherbestimmt ist. Denn insofern eine Zelle nicht „mehr“ als einer Aneinanderreihung von chemischen Vorgängen ist bleibt sie in ihrer Summe kompliziert. Kein Freiheitsgrad würde erklären weshalb Leben so mannigfaltig, variantenreich und vor allem unvorhersehbar ist. Diese „physikalische“ Sicht der Welt würde das Phänomen Leben tatsächlich zu einer Maschine degradieren. Und zwar ganz im klassischen Sinne mit Zahnrädern, Wellen und Riemen – einem biologischen Apparat ohne Freiheitsgrad.
Die Welt der Physik und Chemie beschreibt das Verhältnis von Materie und Energie in Form natürlicher Gesetze: Energieerhaltung, Thermodynamik, Bindungskräfte und wie sie alle heißen. Die Naturgesetze geben klar vor, wie sich Moleküle „zu verhalten“ haben. Was die Naturgesetze hingegen nicht beschreiben ist die Information, die jedem Molekül dieses Universums innewohnt. Denn auch jedes unbelebte Molekül eines lebenden Systems transportiert für das System relevante Information. Information darüber wie es mit anderen Molekülen reagieren kann (chemische Komplementarität), als auch Informationen durch die Zusammensetzung von Molekülen [7]. Durch die Anordnung unbelebter Moleküle zueinander entsteht unser genetischer Code, der Information über die Bauweise und Funktionalität des Gesamtsystems enthält . Es ist daher die Grundlage alles Lebendigen, dass jedes Molekül einer Zelle Materie-, Energie- und Informationsträger zugleich ist.
Denn es gibt kein Naturgesetz das beschreibt, wie aus tausenden Molekülen bestehende Proteine zusammengesetzt werden. Genau diese für das Leben kritischen Information über den Bau aller höheren Strukturen der Zelle sind nicht von den physikalischen Gesetzen abgedeckt. Man könnte sagen, es interessiert die Physik und Chemie nicht, wie Zellen diese komplizierten Gebilde zusammensetzen oder in welcher prozessualen Abfolge sie chemische Reaktionen geschehen lässt. Zumindest solange nicht, solange Zellen sich dabei an die vereinbarten Spielregeln halten. Wir wissen bis heute nicht was dazu geführt hat, dass diese Information in der uns vorliegenden Form zueinander gefunden hat: Durch einen schöpferischen Akt, puren Zufall oder evolutionäre Entwicklung. Doch ist dieses auf Information basierende Zusammenspiel der Moleküle in einer Zelle die Ursache für die Komplexität des Systems. Denn anders als die chemischen Elementarprozesse folgen die Vorgänge der anorganischen Chemie keinen deterministischen Spielregeln mehr. Durch die Kopplung von tausenden von Molekülen zu biologischen Maschinen (Proteine) entsteht ein Grad an Komplexität der eine absolute Sicherheit ausschließt.
Stattdessen folgen die lebenserzeugenden Abläufe innerhalb von Zellen Wahrscheinlichkeiten: Bei der Interpretation der genetischen Information können Fehler passieren. Ein Ribosom kann beim Bau eines Proteins durchaus einmal eine strukturell ähnliche Aminosäure verbauen [3]. Obwohl bei diesen Abläufen Fehler passieren, ist nicht einmal zwingend gesagt, dass das Ergebnis absolut unbrauchbar ist. Organische Abläufe erzeugen Ergebnisse von defekt, vermindert in seiner Funktion bis hin zu schädlich für das Gesamtsystem. In Folge ist auch Zusammenspiel verschiedenster Signal- und Stoffwechselpfade, die alle nach statistischen Gegebenheiten ablaufen, kein festgelegtes Bühnenstück mehr. Stattdessen sind die Interaktionen und Abhängigkeiten zwar höchstwahrscheinlich, aber in letzter Instanz nicht mehr absolut sicher.
Doch das wirft ein Problem auf! Denn potentiell tödliche Fehler dürfen in den Abläufen nicht geschehen, oder das System geht zu Grunde. Damit ein System lebensfähig bleibt, ist es daher zwingend notwendig, dass die Wahrscheinlichkeit aller beteiligten Vorgänge ausreichend hoch ist. Und genau hier kommt die operationale Zuverlässigkeit ins Spiel. Eine hohe operationale Zuverlässigkeit der systemischen Abläufe ist auch das Bindeglied zu anderen lebenden Systemen – darunter auch sozialen Systemen.
Die Zuverlässigkeit des Zusammenspiels aller Elemente sorgen für die Funktionalität des Systems
Doch was genau meine ich mit der operationalen Zuverlässigkeit?
Dieser Tatbestand findet sich bereits in der aus der Beobachtung des Lebenden hervorgegangenen Definition autopoetischer Systeme von Maturana und Varela [5]. Der Begriff autopoetische Systeme stammt aus dem Altgriechischn autos „selbst“ und poesis „schöpferische Tätigkeit“ . Diese Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre eigene Organisation ständig selbst erzeugen. Organisation meint hier genau das Schaffen der benötigten Strukturen und Elemente des Systems, die im komplexen Zusammenwirken die Dynamik des Systems bedingen. In der Zelle sind das alle Moleküle und Proteine, die diese Zelle benötigt, um ihre unzähligen Stoffwechselpfade auszuführen. Maturana und Varela verwenden in diesem Kontext auch häufig den Begriff der autopoetischen Maschine.
Der Begriff Maschine ist für mich ein auffälliger Hinweis auf die operationale Zuverlässigkeit: Bei lebenden Systemen geht es darum dauerhaft, sich wiederholende Abläufe zu reproduzieren – und zwar mit hoher Qualität – eben zuverlässig. Eine Maschine ist nichts anderes als ein Werkzeug, das dazu geschaffen wurde, ein bestimmtes Produkt zu erzeugen – in diesem Fall eben sich selbst. Auch zeichnen sich Maschinen dadurch aus dies nicht nur manchmal, unvollständig oder fehlerhaft zu tun, sondern zuverlässig.
Da Leben basiert also auf dem dauerhafte Reproduzieren von sich selbst erzeugenden Abläufen. Daher ist es zwingend notwendig, dass diese Abläufe mit einer hohen Zuverlässigkeit ablaufen. Nur wenn ein Vorgang den nächsten zuverlässig auslöst entsteht eine dauerhafte Dynamik, die den Fortbestand des Systems ermöglicht. Diese Anschlussfähigkeit ist es auch, die Niklas Luhmann bei der Beschreibung seiner Theorie sozialer Systeme verwendet. Nur wenn ein Vorgang (er verwendet den Begriff Operation) den nächsten Vorgang bedingt entsteht ein System. Der Abbruch von Vorgängen, sprich das Ausbleiben eines Anschlussvorganges, führt zum Erliegen des Systems [6].
Somit ist Leben elementar gesehen nichts anders als durch Information gesteuerte Abläufe von chemischen Reaktionen. Auf eine chemische Reaktion folgt die nächste und immer so weiter. Je zuverlässiger diese Reaktionen verlaufen, desto eher ist das System in der Lage fort zu bestehen. Die Organisation des Systems sorgt also dafür, dass die nötigen Bausteine vorhanden sind und diese korrekt miteinander verbaut werden. Fehler dürfen passieren, aber nur wenn dies nicht zum Erliegen der Ablaufkette führt. Je wichtiger ein Ablauf für das Überleben ist desto zuverlässiger muss er ablaufen. In jeder Zelle finden mehrere Millionen chemische Reaktionen statt und das pro Sekunde. Entsprechend hoch ist die statistische Wahrscheinlichkeit auf Erfolg von weit über 99,999x %. Und nicht nur das: Die Natur hat sogar unterschiedliche Reparatur- und Qualitätssicherung-Mechanismen installiert, die dafür sorgen, dass essenzielle Abläufe, wie die Zellteilung (Mitose) nahezu fehlerfrei ablaufen [8].
Operationale Zuverlässigkeit ist auch für soziale Systeme systemrelevant
In sozialen Systemen ist das auch nicht anders: Nehmen wir an ihre Organisation stellt einen neuen Elektro-Ingenieur ein. Bei der Rollenbeschreibung ihres neuen Kollegen bringt die Organisation die Erwartungen an die Durchführung dieser Rolle durch den neuen Stelleninhaber ein. Beginnt ihr neuer Kollege dann völlig entgegen aller Erwartungen diese Rolle mit Youtube-Streaming, bis zur Schmerzgrenze ausgedehnten Mittagsspaziergängen und fehlerhaften Berechnungen zu füllen, geht die Anschlussfähigkeit von Vorgängen verloren. Zumindest sind die Folgevorgänge nicht so, wie sie die Organisation erwartet hat. Anstelle von produktiven Anschlussvorgängen, werden Personalgespräche mit dem Chef oder aufgeheizte Kaffeeeckengespräche der Kollegen angeschlossen. Die niedrige Zuverlässigkeit, in der die Vorgänge jetzt ablaufen, sind nicht mehr in dem Maße gegeben als sie für den Fortbestand des Systems nötig wären.
Das ist natürlich ein überspitztes Beispiel. Es gilt aber gleichwohl für jegliche Art von Unzuverlässigkeit in Geschäftsprozessen, die ein System nachteilig beeinflussen. Vom defekten Arbeitsgerät, einer wartungsintensiven Maschine bis hin zur schwankenden Gefühlslage des Abteilungsleiters, welche die Prozesszuverlässigkeit in ungesundem Maße beeinträchtigt. Selbst für kreative und innovative Tätigkeit gilt dieser Zusammenhang. Methoden wie Design Thinking beruhen ebenfalls auf der Annahme, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass dem Prozess ein zweckmäßiger Gedanke entspringt.
Es ist also systemtheoretisch gesehen ganz unerheblich ob ein unbelebtes Molekül oder eine Person dazu führt, dass ein Prozess nicht wie beabsichtigt abläuft. Es geht nur um die statistische operationale Zuverlässigkeit der Prozesse in die das Systemelement eingebunden ist. Denn ungeachtet dessen, ob wir über fehlerhaften Prozessketten in Zellen beispielsweise durch Mutation oder defekte Arbeitsmittel sprechen, die Häufigkeit von nicht systemerhaltenden Abläufen macht den Unterschied in der Lebensfähigkeit aus. Je zuverlässiger Abläufe und Systemelemente funktionieren, desto wahrscheinlicher ist der Fortbestand des Systems. Auf einer abstrakten Ebene betrachtet unterschieden sich Stoffwechselprozesse von Zellen und Lebewesen und Geschäftsprozesse von Unternehmen also nicht. Beide Prozessketten funktionieren nur wenn Materie und Energie im ausreichenden Maße vorhanden sind (Naturgesetze) und wenn sie statistisch sicher, also zuverlässig funktionieren (Information).
Lebendige Organisationen nach biologischen Vorbildern. Ja, bitte!
Ich bin davon überzeugt, dass der nächste evolutionäre Schritt für Organisationen sein wird, sich am Vorbild der Natur zu orientieren. Die Natur hat die Fragen der Komplexität, Kollaboration und der optimalen Ressourcennutzung bereits umfassend gelöst. Sie selbst sind das beste Beispiel für 100 Billionen symbiotische Kooperationen, die ihre Zellen tagtäglich leisten. Insbesondere bin ich angetan von der Idee sich dabei nicht nur auf naheliegende Analogien wie Tier zu Organisation zu versteifen, sondern sich an den grundlegenden Eigenschaften aller lebenden Organismen zu orientieren.
Bei der Übertragung ist man jedoch gut beraten die richtige Flughöhe einzunehmen: Es ist sicherlich nicht zielführend sich auf ein zu hohes Detaillevel zu begeben, um Analogien zu finden. Insbesondere in der Molekularbiologie macht es wenig Sinn, sich an eine 1:1 Übersetzung der 20 essenziellen Aminosäuren zu machen und analog 20 elementare Bausteine der Organisation zu suchen. Hingegen ist der dahinter steckende Modularisierungsgedanke, der im Aufbau aller lebenden Strukturen steckt, einen genaueren Blick wert.
Ich hoffe jedoch es ist anschaulich geworden, dass die Übertragung von biologischen Systemen und deren evolutionäre Prinzipien nicht zwingend eine unzulässige Trivialisierung von sozialen Systemen darstellen muss. Dies gilt gleichwohl, wenn man sich mit den fundamentalen Prinzipien des Lebens beschäftigt, die an der Grenze zur unbelebten Welt liegen. Denn beginnend mit den Rahmenbedingungen unseres Universums (Naturgesetze) bis hin zu statistischen Abläufen, teilen beide Arten von komplexen Systemen vergleichbare Wirkungsprinzipien. Hingegen kann die Organisationsbionik einem keinen Aufschluss über gute Führung, menschliches Miteinander und andere Aspekte des sozialen Lebens geben. Sicher ist nur, dass all diese Faktoren ebenso vorhanden sein müssen, um Systeme zuverlässig und damit überlebensfähig zu gestalten.
Lebe lang und erfolgreich!
Literaturhinweise und Buchempfehlungen
[1] Beer, Stafford (1995): Brain of the firm. 2. ed., reprinted. Chichester: John Wiley & Sons (The managerial cybernetics of organization). Seite 73-129 [Affiliate-Links: Englische Version][2] Cerman, Zdenek; Barthlott, Wilhelm; Nieder, Jürgen (2007): Erfindungen der Natur. Bionik – Was wir von Pflanzen und Tieren lernen können. 2. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl. (rororo science, 62024). Seite 259 [Affiliate-Link: Deutsche Version]
[3] Christen, Philipp; Jaussi, Rolf; Benoit, Roger (2016): Biochemie und Molekularbiologie. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum. Seite 12 [Affiliate-Link: Deutsche Ausgabe]
[4] Gleich, A. von; Pade, C.; Petschow, U.; Pissarskoi, E.: Bionik. Aktuelle Trends und zukünftige Potenziale. Seite 18-26 [Link]
[5] Maturana, Humberto R.; Varela, Francisco J. (1980): Autopoesis and Cognition: D. Reidel Publishing Company. Seite 78
[6] Simon, Fritz B. (2018): Einführung in die systemische Organisationstheorie. 6. Auflage. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag (Carl-Auer compact). Seite 22-28 [Affiliate-Link: Deutsche Ausgabe]
[7] Shapiro, James Alan (2013): Evolution. A view from the 21st century. 1. print. with corr. Upper Saddle River, NJ: FT Press Science. [Affiliate-Link: Englische Version]

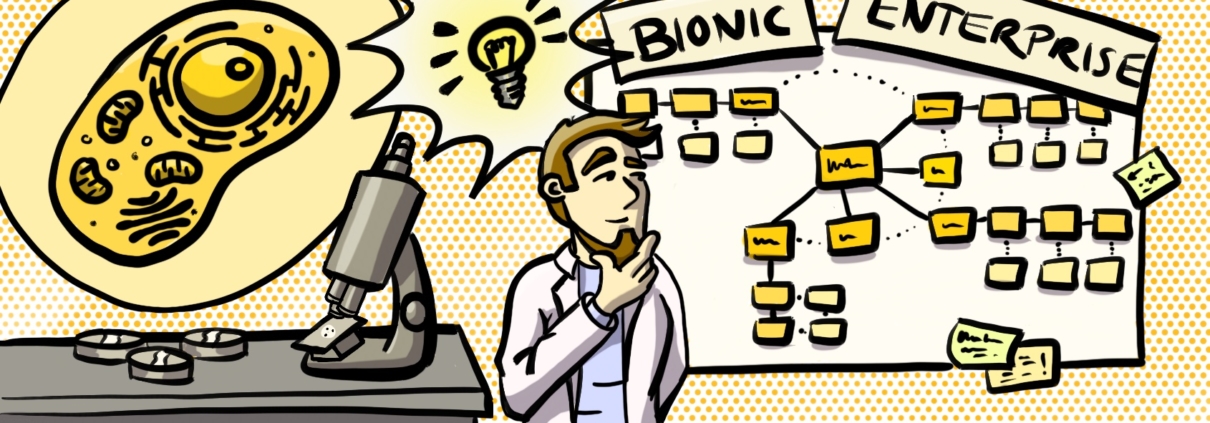




 2019 Moritz Hornung
2019 Moritz Hornung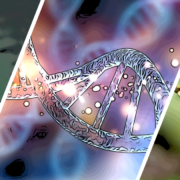




Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!